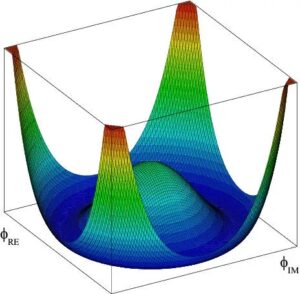Inhalt
Gleich mal Klartext 1
Bethanien. 3
Lazarus. 5
Damaskus. 6
Der Ungläubige Thomas. 8
… und wenn ich wollte, dass er bleibe, bis ich komme, was geht’s dich an?. 10
Der Aufstand. 11
Alexandria. 13
Sergius Paulus. 16
Grüsse nach Philippi 18
Gleich mal Klartext
In den letzten Jahren des vorigen Jahrhunderts – wie sich das anhört für einen, der fast sein ganzes Leben in jenem Jahrhundert verbracht hat – wurde in Kreisen von Neutestamentlern, die sich professionell auch mit dem übrigen christlichen Schrifttum der Frühzeit zu befassen haben, ein Judasevangelium in die Diskussion gebracht. Da dieses Judasevangelium zwar früh entstanden ist, aber bereits die Kreuzigung voraussetzt, die es ja nie gegeben hat, kann es ohne weiteres in die apokryphen Texte des zweiten und dritten Jahrhundert unserer Zeitrechnung eingereiht werden. Über unseren Judas hier, sagt es jedenfalls nichts aus, sondern trieft von Christentum. Als hätte Judas solch eine „Ehrenrettung“ nötig gehabt… er hatte und hat sie so nötig wie wir ein Loch im Knie oder ein fünftes Bein. Es gab jenen Verrat niemals. Er ist dramaturgisch konstruiert worden, um die christliche Passionsgeschichte eröffnen zu können und strotzt nur so von frommem Erfindungsgeist, wobei die Frage, wie denn jemand verraten werden musste, dessen Aufenthaltsort jeder kannte, wohl die bedeutendste, aber keineswegs die einzige ist.
Aber – es stehen Schatten der Erinnerung hinter allen Erwähnungen des Judas. Denn er war es, der nach Jesu Fortgang die Leitung seiner Schülerschaft übernahm und das wird keine kleine Aufgabe gewesen sein, wenn man Jesus als den Lehrer „jener fremden Philosophie“ ansehen will, „die nicht bei uns entstanden ist, aber viele Anhänger in Israel hat“, so Josephus, der nach allem zuverlässigste Chronist jener Zeit. Er ist vor allem zuverlässig, weil er selbst keinerlei Interesse an dieser Philosophie hat, er kennt sie nicht, ist weder dafür, noch dagegen eingestellt. Hier liegt der Schatten besonders auf dem Grund, warum Jesus Israel verlassen muss. Denn es ist sehr wohl etwas geschehen, das Jesus den Kopf kosten könnte, auch unter dem ihm an sich freundlich gesinnten Herodes: das Allerheiligste des Tempels ist entweiht worden, die Bundeslade vernichtet.[1] Jesus muss zusehen, wie er schnell das Meer zwischen sich und Israel bringt. Vielleicht stammt die Legende vom Verräter hierher: nämlich dergestalt, dass Judas diese Begebenheit eben nicht beim hochpriesterlichen Gericht anzeigt, sondern den Frevler entweichen lässt. So wird er zum Verräter – aber nicht an Jesus, sondern an der Sache des Tempels – der ihn im Übrigen nichts mehr angeht. Er hat sein Judentum längst verloren, als dies geschieht.
Wir dürfen in Judas, nachmals genannt „der Zwilling“ den befugten Vollstrecker von Jesu geistigem Vermächtnis sehen. Er ist es, der sich am engsten an den bewunderten Lehrer anschließt, er ist es, der als Einziger der Schüler den Weg zu gehen wagt, den Jesus vorschlägt, er ist es nachmals, der die auseinander laufende Schülerschar wieder sammelt und ihr in Alexandria ein neues Zentrum schafft. Er ist es, der noch das Christentum aufdämmern sieht, denn er ist um einiges jünger als Jesus und er wird sehr alt werden, und sich mit Entschiedenheit dagegen verwahrt, weshalb er auch der Ungläubige genannt wird. Später wird man ihn zwangsweise ins Christentum eingemeinden, aber da ist er schon tot und kann sich nicht mehr wehren.
In der frühen Christenheit ist Judas nichtsdestoweniger bekannt und bei einigen sogar beliebt. Man stellt ihn gerne christusähnlich dar und gibt ihm eine Buchrolle in die Hand als Hinweis darauf, dass er eine eigene Christus – Tradition errichtet haben soll. Lange Jahrhunderte bleibt sein Werk ein Dorn im Fleisch der Orthodoxie, erst im 16. Jahrhundert unserer Zeitrechnung verschwindet es zusammen mit seinen letzten Rezipienten von der Bildfläche. Es tauchen Akten auf, die seinen angeblichen Märtyrertod schildern sollen – an dem freilich aber auch alles erstunken und erlogen ist, aber man will diesen Man und man will ihn als Christen. Denn ohne ihn und sein Werk kann man sich nicht als Christ ausweisen – er ist es, der die Lehre Jesu gestaltet und ihr eine Form gegeben hat und der sich darin als seinem Lehrer kongenial erweist. In koptischer Übersetzung ist diese grundlegende Schrift komplett erhalten geblieben, teilweise auch in Griechisch. Man kann annehmen, dass sie auch auf Lateinisch verbreitet war, denn die Orthodoxie reagierte geradezu hysterisch, wenn die Rede auf dieses Werk kam – aber um die Lehren Jesu kamen auch die Christen nicht herum und so nahmen sie dieselbe in ihre Evangelien auf. Um der Weisheit willen, die in diesen Worten steckt, ist das Christentum noch immer am Leben –aber Kain hat Abel umgebracht und lebt auf dessen Kosten und von dessen Erbe. Kain wäre hier das Christentum im Ganzen. Die Urgestalt des Werkes ist aber in Aramäisch verfasst, der Sprache Jesu und der Sprache des Judas, das konnte durch Rückwärtsvergleiche gesichert werden und die nassforsche Behauptung, es handele sich dabei um ein „epigraphisches Werk“ entbehrt jeder Grundlage, befriedigt aber wohl die christliche Seele und hält – berechtigte – Zweifel fern[2].
Dieser Mann hat uns also die originale Lehre Jesu erhalten – eine Lehre aus einer Zeit, als es noch keinen Jesus Christus gab, sondern nur einen Lehrer, der sich als eines Menschen Sohn bezeichnete und keine Religion, sondern eine Philosophie verbreitete. Allerdings tat er dies unter Juden. Das bedingt, dass ein gewisses unbestimmtes Maß an religiös ausdeutbaren Begriffen in dieser Lehre vorhanden ist, denn anders wäre er von denen, mit denen er zusammentraf nicht verstanden worden – er wurde es dennoch noch schlecht genug, denn die Ohren der meisten Schüler hörten den religiösen Klang auch unaufgefordert mit, es mussten gar nicht einmal solche Superjuden wie Simon sein. Dass indes Judas den religiösen Bereich mitgedacht hat, können wir wohl als unmöglich annehmen. Indessen überlieferte er Jesu Lehre so treu er konnte und auch seine Schüler hatten große Ehrfurcht vor der Überlieferung des Meisters, sodass seine Worte beinahe unverändert auf uns gekommen sind, was sich vor allem dadurch bemerkbar macht, dass dieses kleine Werk immer noch imstande ist, das auszulösen, was einst dem Judas widerfuhr: nämlich dass er wurde wie sein Meister und also dessen Schüler nicht mehr war – auch das überliefert er treulich. Die Lehre Jesu beweist sich vor allem durch ihre Wirkungsgeschichte. Und durch diese Wirkungsgeschichte beweisen sich auch die Übersetzungen als genau und wort- wie begriffsgerecht. Erst die modernen Übertragungen bringen den Evangelienton hinein und verunklären dadurch die Lehre.
Zurück zu Judas. Er hat ein bewegtes Leben gehabt, äußerlich wie innerlich. Er ist alt geworden, älter als sein Meister, der an unbekanntem Ort verstarb. Niemals wieder kehrte er nach Israel zurück. Judas hat Kinder hinterlassen, war also verheiratet, aber über seine Frau wissen wir nichts. Von den Kindern wissen wir aus einer Anekdote, die von Kaiser Domitian überliefert ist. Sie sollen Bauern in Judäa gewesen sein. Dass es seine Kinder gewesen wären, erfahren wir nur dadurch, dass behauptet wird, Jesus habe einen Zwillingsbruder gehabt. Er war unterwegs im gesamten östlichen Mittelmeerraum und besaß mehrere Häuser – in Alexandria, in Damaskus, in Philippi/Mazedonien. Er war befreundet mit hohen Regierungsbeamten – all das deutet darauf hin, dass er kein armer Mann war, aber das war Jesus, sein Lehrer, ja auch nicht.
Bethanien
Bethanien am Ölberg war ein großes Dorf nahe bei Jerusalem. Heute liegt der Ölberg zwischen dem landwirtschaftlich nutzbaren Gebiet um Jerusalem und der Wüste – zu Jesu und Judas Zeiten war das aber ganz anders. Bethanien lag in einer lieblichen, weiten Landschaft, deren Charakter durch Äcker und Weiden bestimmt wurde und diese Landschaft zog sich bis über das Ufer des Toten Meeres hinaus. Erst weit danach begann die arabische Wüste, die sich heute beinahe bis Jerusalem erstreckt. Der Ölberg hatte seinen Namen von den Olivengärten, die sich seine Hänge hinauf zogen. Die Menschen lebten vom Öl, von der Landwirtschaft und Viehzucht und natürlich auch von den Pilgerströmen, die jedes Jahr aus Galiläa durch das Dorf fluteten und wer nicht im überfüllten Jerusalem hausen wollte, der suchte sich hier ein Quartier, sodass nur die Nacht des Passah selbst in Jerusalem verbracht werden musste. Zu Schawuoth und zum Neujahrsfest war der Aufenthalt in der Stadt nicht vorgeschrieben sondern nur die Anwesenheit im Tempel bei den Opferfeiern und beim großen Bußgottesdienst am Versöhnungstag.
Er ist ganz bestimmt nicht unverhofft bei Judas hereingeschneit, der Neffe und Schwiegersohn des Königs Herodes. Leute diesen Kalibers pflegten sich anzumelden, denn sie mussten damit rechnen, dass ihre Gastgeber Vorkehrungen trafen. Aber Platz mag genug im Haus gewesen sein, das nach dem Tod ihres Vaters nun dem Judas und seinen beiden unverheirateten Schwestern gehörte. Noch viele Jahre später vernehmen wir, dass es ein stattliches Anwesen war, in das eines Tages ein Mann namens Jesus einkehrte – vielleicht auf einer seiner vielen Inspektionsreisen, vielleicht unterwegs nach seiner Statthalterschaft Galiläa, vielleicht aber auch auf seiner Reise nach „Damaskus“ am Toten Meer, wo der König ihm einen Wohnsitz geschenkt hatte. Er kam nicht allein, sondern mitten in einem Pulk von Hofleuten und vielleicht reiste seine Familie mit ihm. Marta, die eine Schwester hatte jedenfalls, erfahren wir, genug zu tun und war nicht erfreut darüber, dass die andere Schwester, sobald Jesus eingetroffen war, fasziniert zu seinen Füßen saß und ihm schöne Augen machte, während sie den Überblick über alles allein behalten musste. Sie soll sich denn auch einen Rüffel eingehandelt haben, die Miriam. Aber, was erstaunlich war Jesus verteidigte sie und wies Marta seinerseits zurecht „Lass sie doch zuhören“… er wusste so gut wie Marta, dass die beiden das Brot nicht selber buk und den Wein nicht selber kelterte noch das Herdfeuer versah. Die Schwestern hatten nur acht zu geben, dass alles in Ordnung war – und das konnte Marta auch alleine.
Diese Episode wird überliefert im Johannesevangelium, das im Verdacht steht, auf eine Biographie des historischen Jesus zurück zu gehen, in die späterhin der Passionsbericht eingearbeitet wurde – teilweise unter direkter Zitation der damals bereits kanonisierten „synoptischen Evangelien“. Aus Jesu Privatleben erfahren wir in der Tat in diesem Text am meisten, vieles davon bleibt dennoch rätselhaft, der Fokus der Schrift liegt nämlich nicht auf diesem Leben, sondern auf den diversen Missionspredigten, die damit verknüpft und garantiert nicht von Jesus sind. Irgendwann im zweiten Jahrhundert unserer Zeitrechnung kam nämlich ein Christ auf die Idee, man müsse es nun endgültig mit der Philosophie aufnehmen, damit der Lehrer Jesus aus dem Gedächtnis der Menschen entschwinde und nur der Heiland Jesus Christus übrig bleibe. Er hatte damit wenig Erfolg, aber dadurch, dass er sich eben auf diese Biographie aus der Feder eines Kundigen stützen konnte, fand sein im Übrigen zweifelhaftes Werkchen den Weg in den Kanon der heiligen Schriften des Christentums.
In Bethanien am Ölberg also sind die beiden einander zum ersten Mal begegnet und auch die Schwester des Judas erlag der Faszination, die von dieser so ungewöhnlichen königlichen Hoheit ausging. Nach den sehr seltenen frühen Darstellungen zu urteilen, war Jesus höchstens von mittlerer Größe, hatte dunkle, krause Haare und war, allem jüdischen Herkommen zum Trotz, bartlos. Nach der Mode des königlichen Hofes rasierte er sein Gesicht und kleidete er sich alla greca und er wird wohl neben seiner aramäischen Muttersprache auch das Griechische beherrscht haben, aufgrund einer langen Lebensphase in Ägypten dann auch Ägyptisch, wovon er aber in Judäa kaum Gebrauch machte. Er liebte es, heftig und lebendig zu gestikulieren, wenn er sprach und eine relativ frühe Darstellung zeigt, dass er nicht eben die Ruhe weg hatte und majestätisches Thronen überhaupt nicht liebte. Hier ist es die Weltkugel, von der er am liebsten herunterrutschen würde[3] und er trägt einen kurzen Chiton statt eines langen Hemdes. Irgendetwas muss aber an ihm gewesen sein, das ihn aus der Schar der „Gassenjungen“ heraus hob, denn Judas verfiel dem Älteren mit Haut und Haaren, desgleichen die Schwester; sie gaben das Anwesen in die Hände des Verwalters oder auch des Schwagers (eines ungenannten Ehemannes der Marta) und begaben sich mit Jesus dahin, wohin er eben unterwegs war. Dieser hat Judas übrigens nicht enttäuscht, das Anwesen ernährte ihn lebenslang und sein Ertrag war Bestandteil des kleinen Vermögens, aus dem er seinen Lebensunterhalt bestreiten konnte – freilich hat er aber noch mehr getan, sich den Ruf eines wohlhabenden Mannes zu verdienen als der er dann in Alexandria galt. Sogar die Evangelien wissen noch davon, wenn sie „Judas“ den „Beutel“ zuteilen, also die materielle Versorgung der – fiktiven – Wandergemeinschaft, die es so in Wahrheit niemals gegeben hat. Aber er war nicht der Einzige, der hier Vermögen hatte: auch Simon, aus dem später das Christentum hervorgehen sollte, war nicht arm und Jesus als königlicher Neffe schon gar nicht, denn sein Onkel Herodes war sogar stinkreich und er liebte seinen Neffen und dessen Philosophie „mehr als seinem Ruf guttat“ wie Josephus vermeldet. Unterwegs mag er dennoch gewesen sein – erst von Amts wegen und später auf „Geschäftsreisen“ und jemand wie er reiste natürlich nicht allein.
Lazarus
Da ist noch eine Geschichte, die Judas unmittelbar betrifft. Eine wichtige Geschichte, auch wenn sein Name dabei nur in falschem Zusammenhang fällt. Die Geschichte geht so: Judas, wohl um einmal wieder nach dem Rechten zu sehen, ist daheim in Bethanien, als ihn diese Verwandlung quasi hinterrücks überfällt. Wir alle kennen dies Phänomen: wenn der Stress nachlässt, kommen die Zusammenbrüche. Als Judas und solange er sich im Umfeld Jesu bewegte, kam er nicht zur Ruhe. Nun aber, quasi auf Urlaub, erwischt es ihn und eine Weile noch hat es den Anschein als wäre er krank. Marta schickt nach dem Meister, weil niemand ihm zu helfen vermag, sie tut es hinter seinem Rücken, denn Judas meint, das wäre nicht nötig. Dabei führt er sich auf wie ein Schlafkranker, nur ab und an steht er auf, nimmt etwas zu essen und verschwindet wieder im Bett und dabei verfällt er immer mehr und dann – setzt sein Atem aus und er ist weg. Als Jesus von seiner „Krankheit“ hört, ist ihm klar, was da passiert ist und er meint, wie Judas, seine Anwesenheit wäre nicht vonnöten. Aber dann stellt er fest, Judas hat es übertrieben und findet den Rückweg nicht mehr und das nun wiederum ist nicht im Sinne der Sache, also macht er sich auf die Socken. Er kommt zu spät: die frommen Juden haben den angeblichen Leichnam schon eingewickelt und begraben und Jesus allein weiß, dass dieser Mann nicht tot ist, sondern zurückgebracht werden kann und muss. Denn so will er das nicht, Judas soll von dem erzählen können, was ihm widerfuhr, Jesus braucht einen Gewährsmann, der bestätigen kann, dass seine Lehre wirklich Früchte trägt und nicht nur irgendwelches mystische Gerede ist. Also lässt er sich nicht beirren und wirklich, es gelingt ihm, Judas aus dem Licht zurück zu bringen. Er ist nicht einmal sonderlich beschädigt, ein paar Schrammen bringt er durch Musterarbeit wieder ins Lot[4].
Das Johannesevangelium erzählt die Geschichte, aber sehr ungenau. Judas bekommt in dieser Geschichte einen Ehrentitel „der Eingeweihte“ was auf seinen Status nach diesem hinweist und als Person tritt er als Thomas auf, der da vielsagend meint, „Ja, lasst uns gehen, damit wir mit ihm sterben“, was natürlich nicht auf einen möglichen Tod Jesu gemünzt ist, sondern auf die Teilhabe an dem, was in Bethanien gerade geschieht. Der Name Judas wird ganz unterschlagen, er ist nur demjenigen gegenwärtig, der weiß, dass dieser Zwilling Judas heißt. Aber sie beschreibt genau, wie diese Sache für die Augen Unbeteiligter abgelaufen ist. Wir haben aus der Gegenwart etliche Parallelbeispiele, denn dies ereignet sich immer noch, es geht nicht um Vergangenes, sondern um ein zeitloses Phänomen.
Danach ist Judas einer, der in Bezug auf Jesus wie er geworden ist. Er lebt ein anderes Leben, auch wenn er für jeden derselbe bleibt, der er immer war. Das ist nur äußerlich. Innerlich ist er zu einem geworden, „der die Geheimnisse kennt“ – zu einem Lazarus. Für den späteren Bearbeiter dieses Textes ist es nur eine Totenerweckung, mehr braucht er nicht um den „Messias“ Jesus zu beweisen, an den und dessen Wundertaten man glauben soll. Im Urtext aber hat sicherlich noch mehr gestanden, denkbar ist ein Hinweis auf das, was Judas im Licht erlebt hat und wie er damit fertig wird, sozusagen auf zwei ganz unterschiedlichen Ebenen zu leben. Wäre dieses Buch erhalten geblieben, es wäre sicher eines der fesselndesten der ganzen Antike geworden – aber es ist, bis auf diese paar entstellten Fetzen, eben nicht geblieben, wurde wohl auch später von der Kirche heftig verfolgt wie alle Schriften aus der Frühzeit der Gnosis, denn zu den allerfrühesten Gestalten derselben muss Judas Thomas gerechnet werden. Da ohne sein Werk das Christentum nicht hätte bestehen können, musste man ihm in demselben einen Platz anweisen und man tat es auf die bewährte Weise, dass man die Bestandteile eines Namens in ebenso viele Personen auflöste und die eine, die gemeint war, dadurch unkenntlich machte. So wurden aus Judas dem Zwilling der a)Verräter Judas Iskarioth, b) der ungläubige Thomas, c) Lazarus, der von den Toten auferweckt wurde, vielleicht noch d) Lazarus der in Abrahams Schoß ruht und e) Judas, der ein Haus in der Breiten Straße von Damaskus hat, ganz sicher aber wurde aus ihm der f) Elymas der Magier und g) der gnesie syzyge des Philipperbriefes, welche Betitelung sich bis ins Mittelalter erhalten hat; noch die Katharer schrieben sie an die Wände ihrer Versammlungshöhlen. Eine Vielzahl von Zersplitterungen, die genau der Bedeutung des Judas für die Lehre Jesu entspricht, dieselbe war nämlich ungeheuer.
Damaskus
Damaskus ist eine sehr alte Stadt in Syrien. Sie besteht noch und ist heute die Hauptstadt des Landes, das ebenfalls noch immer besteht. Aber „Damaskus“ ist auch der Name für einen Ort in Israel, genauer gesagt, an dessen östlichster Grenze. Und über dieses Damaskus wird gesprochen, wenn in Bibel und Talmud die Rede über Damaskus geht. Dabei ist es durchaus möglich, dass damit überhaupt keine Tarnung beabsichtigt ist, sondern dass es am Toten Meer wirklich einen Ort gegeben hat, dessen Name ähnlich klang – zumindest aramäischen Ohren – und mit dem es eine für Israel außerordentliche Bedeutung hatte, denn in Damaskus saßen, wie wir erfahren, die Ketzer. Mit diesen setzt sich der Talmud außerordentlich detailliert auseinander, was für die Bedeutung spricht, die sie noch lange nach Herodes in Israel gehabt haben. Er bespricht des Langen und Breiten vor allem das Problem, was mit Büchern geschehen solle, die von diesen Ketzern hergestellt worden sind. Er diskutiert lange, ob man sie aus einem Brand retten solle – was dafür spricht, dass auch Thorarollen dort gefertigt worden sind, denn nur diese waren aus einem Brand zu retten. Und ein fanatischer Jude schreibt einen langen Brief nach „Damaskus“, in dem er die Ketzer dort über die wahren Lehren des jüdischen Glaubens aufklärt und ihnen auseinander setzt, dass auch nicht alle Juden mit der Politik übereinstimmen und übereinstimmten, die in Jerusalem seit den Tagen der Hasmonäer gemacht wurde. Was man in Damaskus über diesen Brief dachte, ist nicht überliefert, der Brief aber wohl. Er fand sich Anfang des vorigen Jahrhunderts in einer Kairener Synagoge an. Da er nach Damaskus adressiert ist, nennt man ihn heute die Damaskusschrift. Ein zweites, wohl das Originalmanuskript fand sich in der Hinterlassenschaft eben der Institution wieder, an die es einst gesandt worden war: die Offizin von (nachmalig so genannt) Qumran.
Was hat man nicht alles in diesen Ort und diesen Fund hinein interpretiert… dabei war der Ort ein Dorf wie viele andere und der Fund eher eine zufällige Ansammlung. Denn hier wurden Bücher hergestellt und zwar von Anfang an. Sie gerbten selbst das Leder, zogen wohl auch das Vieh, leichte Arbeit in einer weitläufigen Grassavanne, schnitten es zu, legten es auf Lager und … dann beschrieben sie es je nach den Aufträgen, die sie bekamen. Für das Geld, das sie bekamen, kauften sie alles, was in der Savanne nicht wuchs, was sie aber brauchten: Lebensmittel, besonders Getreide, Kleidung und alles. was sonst in Haushalten Verwendung fand. Sie lebten in Familien zusammen; man hat ihren Friedhof ausgegraben, darauf befanden sich Männer, Frauen und Kinder jeder Altersstufe. Man hat ihre Müllgruben gefunden, darin befanden sich Knochen und Scherben und Reste von allerhand Pflanzen. Und man hat ihre Gerberbottiche gefunden, in denen das Leder gereinigt und geschmeidig gemacht wurde, die Tische, an denen es immer feiner geschabt wurde, bis es die richtige Qualität erreichte und endlich in die gewünschten Formate zugeschnitten… die Schreibstube fand man indes nicht, denn die Tische dort waren wohl aus Holz und das Haus aus Lehm und beides ist vergangen. Dort und so lebten also die Ketzer um die der Talmud solch ein Wesens macht… und sie lebten von ihrer Hände Arbeit, nicht von frommer Beschaulichkeit, der Ort war kein Kloster, er war ein lebendiges Gemeinwesen und dieses Gemeinwesen wurde von denen verwaltet, die da Ketzer genannt werden, aber vermutlich lebten nicht nur Ketzer dort, sondern Menschen aus allen Fraktionen, in die das Judentum in der Zeit von Herodes dem Großen bis zum ersten jüdischen Krieg, in dem die Siedlung zerstört wurde, zerfallen war.
Bei der Siedlung gab es ein kleines Königsschloss, das Herodes seinem Neffen als Wohnsitz schenkte und wo er mit seiner Familie und seinen Freunden lebte. Zu den Wallfahrtsfesten kamen sie dann auch nach Jerusalem, denn viele seiner Freunde sahen sich durchaus als Juden und außerdem war das eine Gelegenheit, mit den Freunden zusammen zu treffen, die nicht im Dorf wohnten und das waren viele, wie Josephus schreibt: man konnte sie überall antreffen. Aber Herodes kam auch öfters ans Tote Meer, denn dort befanden sich viele Ferienschlösser und zudem brauchte der dann und wann auch die Heilquellen, die an seinem Ufer entsprangen – er litt an einer heimtückischen Krankheit, die durch solche Bäderkuren gelindert, manchmal beinahe zum Abheilen gebracht wurde. Dann sah er wohl auch nach der Tochter und nach dem Neffen und ob es ihnen auch wohl erginge, denn er liebte die beiden und seine Enkel schon deshalb, weil sie die einzigen in der Familie waren, die nicht auf den Thron scharf waren und keiner politischen Partei die Steigbügel hielten. In diesem Umfeld lebte nun auch Judas, der sich Jesus eng angeschlossen hatte, lebte eine Zeitlang auch seine Schwester, ehe sie in Magdala ein eigenes Quartier bezog und nur noch zu Besuch kam.
Der Umsatz der Offizin stimmte wohl, denn sonst hätte sich die rabbinische Literatur kaum um sie bemüht. Überall im Lande kursierten ihre Exemplare und kam auf die Märkte und den orthodoxen Juden vor die Augen, bestachen durch ihre sorgfältige Ausführung und es waren beileibe nicht nur Schriften der Gruppe, sondern im Gegenteil, mit ihrem eigenen Wissen hielten sie sehr zurück, aber sie stellten ihre Fähigkeiten der Allgemeinheit zur Verfügung und wenn die Rabbinen die Schriften bis zum Ursprung verfolgten, erfolgte meist ein Aufschrei – denn die Leute aus „Damaskus“ hielten mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg. Für ihre Kunden arbeiteten sie mit koscheren Häuten und sogar in Metall, wenn es gewünscht wurde, aber für sich selbst, nein, für sich selbst „aßen“ sie „was man ihnen vorsetzte“ und genierten sich nicht, fasteten nicht, beteten nicht (und jüdische Gebete fressen Zeit…) und sie gaben auch keine Almosen, denn sie hatten immer irgendeine Arbeit zu vergeben – dem, der arbeiten wollte. Auch als Jesus weg war, arbeitete der Betrieb weiter unter Judas‘ Leitung und sogar nach Judas‘ Weggang war noch kein Ende abzusehen, Jakob, ein Bruder Jesu, führte den Betrieb nahtlos weiter und nach ihm kamen andere und wieder andere – Damaskus blieb ein Dorn im Fleisch der orthodoxen Juden, den sie nicht heraus ziehen konnten, denn die Leute machten schlicht nichts falsch… sie machten es nur anders. Beinahe hundert Jahre bestand der Betrieb, ehe die Stiefel römischer Legionäre alles niedertrampelten. Man wendet gegen diese Lesart ein, dass man keinerlei Schreibwerkzeug in Qumran gefunden hätte… nun ich halte diesen Einwand für recht schwach, denn nicht mehr als die Grundmauern der Siedlung sind auf uns gekommen und damit nur ein ganz geringer Teil dessen, was sie einst ausgemacht hat. Man hat eingewendet, dass die Wohnstätten für 500 Mitarbeiter nicht gefunden worden wären, aber erstens, woher will man wissen, dass es so viele waren, zweitens muss man die Bauweise einfacher Lehmbauten kennen, um zu wissen, dass sich von einem leichten Haus aus ebenerdig an Pfählen ausgespannten Matten, die mit Lehm beworfen und mit einem Dach aus Astgeflecht gedeckt werden, nach zweitausend Jahren nichts mehr auffinden lässt. Dies aber war die gebräuchliche Bauweise für die Häuser der Armen, nur die Wohlhabenderen legte Fundamente und wie wir ebenfalls sehen, gab es solche wohl am Ort, die Siedlung bestand aus den Häusern der Sesshaften und aus den Hütten der Wanderarbeiter, die niemand zählte und die auch die Archäologen zweitausend Jahre später nicht gezählt haben dürften.
Hier also wohnte Judas und hier, in der Hauptstraße[5] des Ortes, hatte er sein festes Haus. Hierher wurde der Talmudreferendar Saulus mit seiner Schar geschickt und hier öffnete Judas ihm die Augen – leider aber nicht weit genug, wie man dann wohl gesehen hat, denn der eben Erweckte ging zur Fraktion der messiasgläubigen Jünger des Simon über, was Judas sicher nicht beabsichtigt hatte. Da war er, wenn wir in Betracht ziehen, dass er bedeutend jünger war als sein ferner Meister, etwa ein Mann in den Fünfzigern, Saul wohl um die Mitte der Zwanziger. Jesus, an unbekanntem Ort, war damals vielleicht schon tot, auf jeden Fall aber ein alter Mann.
Aber auf jeden Fall ist es wahrscheinlicher, dass Saul in dieses „Damaskus“ gesandt wurde als in die syrische Großstadt, denn was hatten die orthodoxen Juden dort zu suchen – gar nichts und sie hatten auch keine irgendwie gearteten Glaubensbeziehungen dorthin. Sicher – Juden gab es überall im Reich, aber zumeist ging es den Jerusalemer Tempelklerus herzlich wenig an, was diese Juden trieben, der Hohe Rat der Priester war kein Inquisitionstribunal. Wenn sich allerdings in Israel selbst und auch noch in relevanter Größenordnung eine Ketzerei erhob, dann war der Hohe Rat zuerst gefordert, denn der römische Verwaltungsapparat kümmerte sich um dergleichen nicht. Dass ein junger, aufstrebender Pharisäer dann ans Tote Meer geschickt wird um nach dem Rechten zu sehen, ist glaubwürdig, gehört dies Gebiet doch zu Israel. Christen aufheben sollte er aber bestimmt nicht, denn Christen gab es eigentlich noch gar nicht, es gab vorerst nur die beiden Parteien, die des Simon und die des Judas, die beide eine ketzerische Philosophie vertraten, allerdings erwies sich Simon als bei aller Philosophie doch gut jüdischer Mann, während Judas… na ja. Simon machte nicht viel von sich reden, aber Judas umso mehr mit seinem „Verlag“ in der Savanne und so wollte man sich das genauer ansehen. Aber dann passiert dieses Ding – Saul, ausgeschickt, die Lage einzuschätzen, nicht etwa jemanden zu verhaften, wird selbst Anhänger des Judas und kann deshalb nicht nach Jerusalem zurückkehren, sondern geht erst einmal weiter nach Osten hinein zu den Arabern ihm westlichen Grenzland. Denn wie soll er das seinen Auftraggebern erklären… besser nicht.
Alles andere ist orientalischer Honigkuchen…. viel zu süß und viel zu klebrig aber sehr, sehr lecker… wer einmal einen für Rosch Hashana zubereiteten Honigkuchen gegessen hat, der wie Schaum auf der Zunge zergeht und selbst im Mund noch köstlich duftet, wird mich verstehen. Es ist zwar süß – aber es ist nichts „daran“.
Der ungläubige Thomas
Judas hat bei den Schülern des Simon einen sehr schlechten Ruf. Man kann ihm nämlich nichts weis machen, er fragt immer nach und wehe, jemand hat keine schlüssige Antwort parat oder erzählt gar Gewäsch, dann ist der dran. Andererseits: wenn Judas sagt, etwas ist so oder so, dann kann man sich darauf verlassen, dass es auch so ist. Also – einerseits kann ihn die Gemeinde des Simon wegen seiner Wahrheitsliebe ganz und gar nicht leiden, andererseits braucht sie gerade diese, um sich selbst ins rechte Licht zu setzen. Wenn Judas sie unterstützen würde… aber der tut’s nicht. Denn was der Simon da erzählt, ist von vorne bis hinten Gewäsch und teilweise sogar geradeheraus gelogen. Niemals hat Jesus dem Simon bescheinigt, dass er ihn als Gottes Sohn erkannt habe, sondern es steht überliefert, dass Simon gesagt hat: du gleichst einem besonnen Menschen. Zudem – dem Geschrei über die Auferstehung ist Judas von vorherein ebenso energisch entgegen getreten wie der Geschichte von der angeblichen Kreuzigung, die bald nach Jesu Weggang bei einigen ehemaligen Schülern Jesu umgeht. Kreuzigungen, das gesteht Judas gerne zu, gibt es seit die Römer regieren massenhaft und überall, denn die Dummen sterben bekanntlich nie aus. Aber Jesus ist nie auch nur in die Nähe eines Kreuzes gekommen. Simon lügt und er lügt mit Absicht, trifft sich in seinem Lügengewebe mit einem anderen Betrüger, der behauptet, ein von den Toten Auferstandener zu sein … und der sich mit Aussprüchen des Meisters schmückt, die er allesamt in die Richtung eines messianischen Judentums interpretiert – das ganze Gegenteil also zu dem, was Jesu Anliegen wirklich war. Dieser Betrüger und sein Betrug sind gleichfalls unvergessen, die Mandäer bewahren sein Andenken, ihm allerdings nicht zum Segen.
Aber die Religion des Simon hatte Erfolg in diesen aufgeregten Zeiten in Israel, da vor allem die kleinen Leute sehnlichst auf die Befreiung aus doppelter Knechtschaft warteten, denn die eigenen Reichen bedrückten sie beinahe noch schwerer als die Fremden. Sie erhoben im Auftrag der Fremden die Steuern und sie sorgten dafür, dass sie bei diesen Erhebungen selber nicht zu kurz kamen. Rom alleine, die Tempelsteuer alleine – das wäre allenfalls noch zu stemmen gewesen, aber alle die Draufgelder, die von den Priestern verlangt wurden, alle die Spesen, die sie sich natürlich von den Armen erstatten ließen… das war zu viel. Andererseits erschien Rom unüberwindlich und war Erhebung gegen den Tempel und seine Priesterschaft nicht Auflehnung gegen Jahwe und seinen erklärten Willen, wie er im Gesetz verkündet worden war? Aber – nun kam Simon mit seinem neuen Gott der Liebe und Gerechtigkeit, die gerade den Armen zuteilwerden sollte, also solchen wie ihnen, und der den Reichen fluchte – der kam gerade richtig und die Massen bekannten sich in einem vorher nie dagewesenen Umfang zu diesem neuen Gott. Grund genug für die Priester, zu den Römern zu laufen und um Schutz zu flehen, war doch anscheinend sogar der neue König, der Sohn des großen Herodes, in die Sache involviert und muckte gegen Augustus und den Hohen Rat auf. Der schuf schnell Ordnung, setzte ihn ab und ernannte einen Römer, Coponius über den man nicht viel mehr als den Namen sagen kann, zum Sachwalter Roms in Judäa – alles sollte so bleiben wie es gewesen war, denn diese Lösung hatte sich im ganzen Imperium bewährt: wenn es möglich war, mit der Zustimmung der herrschenden Klasse zu arbeiten und wenn nicht, dieselbe zu zerschlagen. Hier hatte es sich als nicht notwendig erwiesen, denn der heimische Adel kooperierte mit den Römern. Die Religion des Simon versank, nachdem sie etwas Lärm gemacht hatte, wieder in der Versenkung aus der sie aufgestiegen war und ein Zyniker schrieb später ins Neue Testament hinein: Arme habt ihr allezeit bei euch…
Aber es gab auch noch anderen Gegenwind und der kam aus der Richtung der Philosophie, wo Judas den ganzen Zirkus, den man um seinen Meister anstellte, natürlich nicht billigen konnte, wusste er es doch nun ganz bestimmt besser und so lehrte er auch die neue Generation, die da inmitten des Judentums heranwuchs. Gegen die Bewegung dieser „Ketzer“ aber unternahm Rom nichts, denn die störten seine Kreise nicht. Die Philosophen waren ihnen sogar genehm, waren sie doch dezidiert unpolitisch und scheinbar ganz auf Innerlichkeit fixiert. Und so kamen die Schüler Simons auf eine andere Idee – anstatt dass sie die Anderen vernichteten, konnten sie sie doch ebenso gut auffressen: und so wurde Maria Magdalena zur Kronzeugin der Auferstehung und sie und Judas wurden gleich in mehrere Personen zerteilt: den Verräter Iskarioth zunächst dann aber auch den ungläubigen Thomas, der erst durch eine leibliche Begegnung mit dem Auferstandenen zum Glauben findet, aber immerhin – ab dann glaubt er. Maria wurde bezeichnenderweise einmal zur Gottesmutter, dann aber auch zur Dirne, zur Zeugin der Kreuzigung ehe sie zur ersten Zeugin der leiblichen Auferstehung Jesu wurde.
Was Judas angeht, so spiegelt sich in der Geschichte vom ungläubigen Thomas sehr viel Wahres: denn in der Tat hat Judas den Jüngern des Simon ihre Geschichte nicht nur nicht abgenommen, sondern er hat auch unter ihnen kräftig dagegen gearbeitet und wohl auch viele von Simon und seinen Märchen abwendig machen können, sodass die Verleumdung des Judas als Verräter und Umfaller zu einer Existenzfrage für die junge Religion geworden war. Die beiden nach Jesus größten und einflussreichsten Lehrer der Philosophie, eben Judas und Miriam mussten demontiert werden, auch wenn man ihrer leiblich nicht mehr habhaft werden konnte. Und so eignet der Geschichte vom ungläubigen Thomas zwar jede Menge früheste Ideengeschichte des Christentums, aber – Wahrheit eignet ihr überhaupt keine. Indessen überliefert zumindest das Johannesevangelium auch, wie wir schon gesehen haben, etliche wahre Begebenheiten: Eine wollen wir uns gleich einmal anschauen. Denn sie hat intensiv mit Judas Thomas zu tun.
… und wenn ich wollte, dass er bleibe bis ich komme, was geht’s dich an?
Ich meine die Szene am Meeresstrand, die im Johannesevangelium zur Szene am Seestrand wird, der Abschiedscharakter aber bleibt. Jesus verlässt das Land und ordnet so gut es geht, seine Nachfolge. Der „Jünger, den er liebhat“ ist Judas Thomas. Simon drängt sich dazwischen, in diesen Abschied hinein, er ist eifersüchtig auf den Liebling. Jesus hat nie „weide meine Lämmer“ zu Simon gesagt, denn es gab keine Lämmer zu weiden, die Schüler waren für sich selbst verantwortlich. DEN Satz können wir also getrost vergessen. Aber diesen anderen nicht: „und wenn ich wollte, dass er bleibe bis ich komme, was geht’s dich an“ – denn diesen Satz hat Jesus ganz ohne Zweifel zu Simon gesagt, er passt. Er passt zu allen übrigen Sätzen, die den Simon meinen, denn der hat selten gute Karten – so selten, dass selbst die Evangelien den Satz „weiche von mir, Satan“, auch er zu Simon gesagt, nicht streichen oder verhehlen. Simon schneidet nirgendwo gut ab und wo er es doch tut, hat man es nachträglich hinein geschrieben wie das berühmte „weide meine Lämmer“ und das noch viel berühmtere „tu es Petrus et in petrum istum ecclesiam meam aedificabo… „ und so weiter. Jesus stellt hier aber die Dinge klar: die Nachfolge gehört Judas Thomas und Simon hat ihm nicht dreinzureden; bis Jesus wiederkommt, wird Judas der Meister sein, denn Jesus hat durchaus vor, wiederzukommen, auch wenn draußen schon das Schiff liegt, das ihn wegführen wird aus Israel. Dass und wie sich die Dinge dann entwickeln kann noch niemand ahnen, auch er ahnt es nicht in dieser Stunde. Es gilt vielmehr der Rat des getreuen Beraters: lass ihn ein Jahr gehen, ein Jahr bleiben und ein Jahr wiederkommen. Dann wird, so hoffen alle, Gras über die Sache gewachsen sein… da aber Simon Boëthos[6] unterwegs verloren ging, was nicht abzusehen gewesen war, musste Jesus in der Fremde bleiben. Mehr noch – er musste sich in Gegenden begeben, in denen weder das jüdische, noch das römische Recht galten, denn Tempelfrevel wurde von Juden wie von Römern bestraft. Diese Gegenden gab es nur im äußersten Westen, in dem man Heiligtümer nicht kannte, sondern die Götter auf freier Flur verehrte und dann führte man die Ochsen über das Land oder ließ die Pferde und Rinder darauf weiden[7].
Dies alles war freilich in dem Augenblick, den der sogenannte erste Johannesschluss hier festhält, noch in weiter Ferne. Hier geht es um die Konsolidierung der kleinen Gemeinschaft, die weiter machen soll, auch wenn ihr Meister – erst mal für einige Zeit – fern ist. In dieser Zeit soll Judas die Gemeinschaft leiten und Simon, dem das nicht gefällt, soll den Mund halten. Es ist davon auszugehen, dass diese Anordnung dann auch befolgt wurde und der also Zurückgewiesene dies zum Anlass nahm, seine eigene Gemeinschaft zu gründen, in der er seine Vorstellungen von seinem Meister ungestört weiterentwickeln konnte. Judas wird der bevollmächtigte Verwalter des Gedankengutes Jesu, während Simon der Hirte irgendwelcher Lämmer wird, die gehütet werden müssen, also, im unsere Begriffswelt übertragen, der Guru einer neuen, auf einem Zweig der jüdischen Religion basierenden Sekte. Judas zieht sich nach „Damaskus“ zurück, wo er den Kern einer philosophischen Schule um sich sammelt und die Methode der Erkenntnis an Menschen – Männer wie Frauen – weitergibt, die dann ihrerseits für deren weitere Verbreitung sorgen sollen. Um ihn für seine Tätigkeit freizustellen, übernimmt Jakobus, einer der leiblichen Brüder Jesu die Verwaltung des Betriebes. Vielleicht aus diesem Grund nennen die anderen ihn „den Gerechten“ – er erledigt seine Arbeit ordentlich und gewissenhaft. Die Freunde und die Angestellten fühlen sich gleichermaßen bei ihm geborgen. Auf diesem Hintergrund ist wohl der Spruch zu verstehen, dass „um seinetwillen (Jakob) Himmel und Erde entstanden sind: er gilt als der Typus des umsichtig tätigen Menschen, der seinen Aufgabenkreis kennt und gewissenhaft zu handhaben weiß. Die Saat, die Jesus in Israel gesät hat, wird aufgehen und soll sich Korn um Korn vermehren und in der Tat, sie vermehrte sich, denn Josephus, der uns von ihr als der Philosophie berichtet, „die nicht bei uns entstanden ist“ muss auch berichten, dass sie „bei uns viele Anhänger hat“. Da ist die Zeit, von der hier die Rede ist, bereits Vergangenheit.
Der Aufstand
Ob es dieser war oder ein anderer? Dieser meint den Aufstand, der losbrach, als Augustus dem Archelaos das Königtum entzog und Israel dem Imperium einverleibte. Denn Archelaos erwies sich, entgegen den Erwartungen, als seinem Vater durchaus ebenbürtig, was besonders die Jerusalemer Priester entsetzte, die sich nun endlich eine geruhsame Hegemonie erhofft hatten. Aber Archelaos war in der Atmosphäre des herodianischen Königshofes erzogen, ein Freigeist wie sein Vater und möglicherweise noch tatkräftiger und motivierter als dieser, ein König Israels, kein römischer Vasall und auch kein gehorsamer Untertan des Klerus. Das passte nun den einen wie den anderen nicht und so konträr sie auch standen, in diesem Falle hielten sie gegen ihn zusammen, wie man aus der Schilderung des Josephus entnehmen kann. Dem Volk nun wieder passte die Politik der Römer ebenso wenig wie die der Priester und sie wollten ihren König und ihre Unabhängigkeit behalten soweit sie die noch behalten konnten, also revoltierten sie gegen Augustus und seinen Präfekten Coponius – aber sie revoltierten vergeblich. Auch die Anhänger der Philosophie sympathisierten in diesen Tagen mit Archelaos und das soll so weit gegangen sein, dass ihre beiden Anführer, Judas und Jakobus, selbst nach Jerusalem kamen um an der Spitze einer ausgewählten Schar nicht etwa den Römern, sondern den Priestern Schwierigkeiten zu machen. Sie besetzten den Tempel, aber die Römer kamen den sonst eher Vernachlässigten zu Hilfe, weil es eben der Wille ihres Kaisers war, dass Rom hier regieren sollte. Jakobus wurde infolge der Unruhen getötet und Judas rettete zwar sein Leben, musste aber das Land verlassen. Er floh aber nicht wie Jesus, sondern er tauchte unter, zwar nicht in Israel, aber doch in dessen Nähe. Was nun aus dem Ort in der Wüste wurde? Nun, da noch Saul im Haus des Judas Wohnung nehmen kann, ist anzunehmen, dass dieses Untertauchen nur zeitweilig war und Judas nach einiger Zeit zurückkehren und seine Aufgabe wieder übernehmen konnte. Wer achtete denn schon darauf, was in einem abgelegenen Dorf geschah, wenn die Steuern aus diesem regelmäßig und richtig eingingen? Niemand. Natürlich zeterten die Pharisäer weiter, aber niemand Maßgeblicher hörte auf sie und wohl auch die Unmaßgeblichen taten es nicht, denn sonst hätten wir die erbitterten Polemiken gegen die Bücher der Ketzer wohl nicht im Talmud und sonst würde sich Josephus[8], der Priester, wohl nicht so spitz über die fremde Philosophie auslassen. Es ging also alles weiter seinen Gang und doch hatte sich durch den zeitweiligen Untergrundaufenthalt des Judas etwas verändert: der Geltungsbereich der Philosophie war dabei, sich entscheidend zu erweitern. Nun gab es auch in jener Stadt Anhänger der Philosophie, über die gleich berichtet werden soll, da sie späterhin für Judas noch eine große Rolle spielen sollte.
Aufstände gab es in Judäa mindestens in jedem Jahr seit der Besetzung durch die Römer etliche. Einige hatten größeren, die meisten nur kleineren Umfang. Einer dieser Aufstände aber sticht – noch vor dem ersten Jüdischen Krieg – aus den anderen heraus: der Aufstand vom Ölberg, der etwa um den Zeitraum 40 – 50 unserer Zeitrechnung zu datieren ist und dessen Verlauf seinen Schatten auf die „Passionsgeschichte“ warf[9]. Denn jener „Betrüger“ von dem Josephus schreibt, sammelte etliche tausend Anhänger auf dem Ölberg und musste unter Aufbietung einer ganzen Kohorte dort herunter geholt werden… dieser Schatten fällt auf die biblische „Gefangennahme Jesu“ im „Garten Gethsemane“. Natürlich war der historische Jesus an alledem gänzlich unbeteiligt und es steht auch dahin, ob sein Nachfolger Judas hinein verwickelt gewesen ist, der dann ja außerdem schon hoch betagt gewesen sein müsste, etwas zu hoch betagt für meinen Geschmack und für die damalige Lebenserwartung selbst gut situierter Unternehmer. Denn Jesus verließ Israel um das Jahr 23 vor unserer Zeitrechnung und damals war Judas zwar ein junger Mann, aber kein Knabe mehr und auch den Jünglingsalter entwachsen. Er müsste also über die Maßen alt geworden sein, um sich an diesem Aufstand beteiligen zu können. Wenn es einen Aufstand gegeben hat, nach dem Judas Israel für immer verließ, kann es nur einer der vielen ungenannten gewesen sein. Hingegen stellt die Begegnung von Saul und Judas in „Damaskus“ keine chronologische Hürde dar, wenn wir bedenken, dass wir die ersten Schriftzeugnisse paulinischer Briefe aus der Zeit um 50 unserer Zeitrechnung haben… und zwischen der Sammlung und dem Schreiben mag einige Zeit vergangen sein, wobei 50 unserer Zeitrechnung auch nur eine mehr oder weniger gesicherte Vermutung ist, wie fast alles im neutestamentlichen Umfeld sich im Bereich der Spekulation bewegt, was als „eherne Tatsache“ ausgegeben wird. Wir dürfen daher die Sache mit Saul und Judas durchaus vorverlegen. Wir dürfen sie sogar in die Tage vor der Machtergreifung Roms in Israel verlegen, denn dann bekommt sogar der sonst recht eigenwillige Einsatz Sauls als „Inquisitor“ des Hohen Rates einen Sinn. Unter Archelaos hatte, wie auch unter Herodes, der Hohe Rat in religiösen Dingen die alleinige Entscheidungsgewalt und konnte wohl Tempelsoldaten ans Tote Meer schicken, wohingegen Archelaos alle Hände voll damit zu tun gehabt haben dürfte, seine ererbte Herrschaft zu konsolidieren. Wichtig ist aber: Judas ist als Saul dort ankommt, vor Ort und nimmt den „Bekehrten“ in Empfang. An dieser wundersamen Bekehrung ist indes zu zweifeln, am Zusammentreffen der Beiden hingegen nicht und auch nicht daran, dass es Judas gelungen ist, den jungen Saul zu faszinieren, sodass er von seinem ursprünglichen Vorhaben Abstand nahm. Wenn dies alles vor dem besagten Aufstand geschehen ist, in dem Jakobus umkam, können wir diesen als Klimax der Ereignisse betrachten und als den Punkt, an dem die Lehre Jesu ihr Zentrum von Israel an jenen anderen Punkt der antiken Welt verlagerte, der seit jeher sowohl Zufluchtsort für Juden als auch kultureller Mittelpunkt der hellenistischen Welt gewesen ist. Dann lag, anderer Ansatz, die Leitung von „Damaskus“ fortan in den Händen Unbekannter und es mag dann schon sein, dass sich der Ort nach und nach in ein reines Sammelbecken unzufriedener Juden und Gegner Roms wie auch der mit diesem kollaborierenden Jerusalemer Geistlichkeit verwandelt hat und dass er als ein solcher dann von den Römern zerstört wurde. Uns hingegen von der Zeit nach Pilatus als Datierung zu verabschieden, dürfte umso leichter fallen, als sich die Entwicklung der Dinge in den Jahren 4 – 6 unserer Zeitrechnung weitaus sinnvoller darstellt als in so viel späterer Zeit. Gehen wir also im Gegensatz zu unserer ersten Annahme, davon aus, dass Jakobus umkam, Judas aber sich nach Alexandria rettete und fortan dort blieb.
Alexandria
Über Alexandria ist unglaublich viel geschrieben worden, Kluges und unsäglich Dummes. Denn die alte Stadt ist entweder mit der neuen überbaut oder im Meer versunken. Nur noch ganz wenige Bereiche des alten Alexandria sind uns heute noch zugänglich, so das Fundament des Pharos und der Friedhof der Ptolemäer nebst einer Zisterne und ein paar Säulen. Wir wissen nichts mehr von den beiden Boulevards, welche die Stadt von Ost nach Westen durchschnitten und die auf ihren beiden Seiten einen Kanal säumten der, vom Mareotissee, dem Süßwasserreservoir der Stadt, gespeist, Alexandria mit dem östlich davon gelegenen Kanopos verband und westlich der Stadt zu den verschiedenen Friedhöfen der Juden, der Griechen und der Ägypter führte. Wir wissen nichts mehr von der Halbinsel Lochias, die ganz und gar königlicher Besitz war und gegen die Stadt von der großen Basileia, dem ptolemäischen Königspalast abgeriegelt wurde. Wir kennen allenfalls noch Trümmer einiger Lustschlösser, einer Art Pavillons, die sich im Hafenbecken erhoben, denn der Hafen wies eine Anzahl Untiefen auf, die so bebaut nicht mehr zu Gefahren für die Schiffe werden konnten. Wir wissen aber von dieser Stadt so gut wie nichts mehr, nichts von ihren drei Häfen, dem Passagier-, dem Fracht- und dem Königshafen, wir sehen die neue Bibliothek am Strand und wissen dass die alte inmitten der Stadt stand und ein Bestandteil des Museions war. Wir haben ein paar Säulen, aber keine Vorstellung mehr von dem riesigen Serapistempel, der wie das Museion mehrere Gebäude, Plätze und Parks zusammen fasste, wir wissen nicht mehr, wo Juden, Griechen und Ägypter ihre Quartiere hatten, die sie wie Städte in der Stadt selbst verwalteten. Wir kennen den Standort der großen Synagoge nicht mehr, die mit ihrem als Atrium gestalteten Hof viele tausend Besucher fassen konnte und die vor dem Bau des herodianischen Tempels wohl das prächtigste Haus des Judentums war. Wir kennen die stillen Straßen und Gassen nicht, nicht die verwunschenen Plätze an denen Brunnen sprudelten und Bäume über die Mauern der Anwesen nickten, denn städtisches Grün gab es in Alexandria nicht. Wir wissen nicht mehr, wo die Ägypter ihre „Haustempel“ hatten und wie es in ihrem sicher nicht so stillen Quartier ausgesehen hat, denn Ägypter sind ein lautes und quirliges Völkchen, das sich nicht gern hinter Mauern einsperren lässt, während Griechen und Juden Straßen nur betreten um etwas oder sich selbst von hier nach da zu bewegen. Das Leben spielt sich in den Anwesen ab, während es sich bei Ägyptern beinahe ganz im Freien ereignet. Und dann die großen Boulevards, welche die Stadt in alle vier Himmelsrichtungen durchschnitten, aber nur zwei von ihnen waren repräsentativ gestaltet, die andern beiden waren eben breite Fahrstraßen, eine zur Basileia und dem anschließenden Diplomatenviertel, eine andere zum Passagier- und Frachthafen, die im Sommer heiß, leer und, von hohen Häusern gesäumt, abweisend waren, wenn nicht Gesandtschaften oder Reisegruppen sie durchquerten, denn Alexandria war, für sich und als Tor nach Ägypten, ein berühmtes Touristenziel. Andere Touristenziele waren Rhodos, Athen, Korinth die Stätten von Olympia, Ephesos[10] und Pergamon, aber auch das wunderschöne, grüne Antiochia[11] am Orontes in Syrien wurde gern aufgesucht. Stoßweise wurden also auch die schnurgeraden Nord – Süd – Verbindungen benutzt, aber das Leben spielte sich in den Quartieren ab, die durch sie und den inneren Boulevard, sowie durch die Stadtmauer begrenzt wurden, denn Alexandria war nicht, wie Rom, eine offene Stadt. Es hatte, zum Land hin, Mauern und Bastionen, denn man musste erstens immer gewärtig sein, dass Aufstände ausbrachen und zweitens auch mit Angriffen aus Richtung Nordafrika rechnen. Alexandria war nicht Ägypten, auch wenn es ägyptische Züge trug – Alexandria war vielmehr griechisch und viele Ägypter sahen in der Stadt einen Fremdkörper, der gleichwohl die echten Ägypter schikanierte und ausbeutete.
Dann aber gab es noch die Boulevards – und auf ihnen traf sich die Welt. führte ihren Reichtum und ihr Ansehen oder auch einfach nur sich selber spazieren. An den Boulevards lagen die elegantesten Läden, die feinsten Herbergen und dazwischen lag alles, was Geschäfte machen wollte, hier waren die Quartiersgrenzen aufgehoben und der Jude hatte sein Geschäft neben dem Ägypter oder dem Griechen oder dem Syrer, dazwischen standen die Heiligtümer aller Nationen und aller Götter von der einfachen Wandkapelle bis hin zum modernen Tempelhaus. Um das Museion aber, im Westen der Stadt, sammelten sich die privaten Akademien, für Dichtkunst, Tanz und Schauspiel, Musik und Rhetorik und eben auch für diverse Philosophien. Dort hatte später auch die Schule des Judas, der sich hier Didymos nannte, ihren Sitz, aber erst einmal musste der Gründer selbst einen Ort für sich finden.
Das war nicht besonders schwer… denn es gab viele Juden in der Stadt, sie beherbergte nach Jerusalem selbst die größte Gemeinde. Es war nur nötig, ein wenig Geld zu besitzen – was Judas zweifellos hatte – und dann war noch nötig, am Sabbat in die große Synagoge zu gehen, denn dort traf sich die gesamte feine jüdische Welt, all die Bankiers, Groß- und Fernhändler und Großindustrieelle, also Besitzer großer Manufakturen, die bereits industriell arbeiteten. Der Besitzer einer bereits wohl bekannten Offizin hatte keine Schwierigkeiten, in diesen Kreis aufgenommen zu werden, zumal schon deshalb, weil modernes Verlagswesen in Judäa sonst so gut wie unbekannt, in der hellenischen Welt aber die Regel war, Judas also als eine Art Pionier galt. Es mag ihn selbst überrascht haben, wie leicht er Zugang fand – aber etliche Manuskripte aus seiner Faktorei hatten den Weg nach Alexandria gefunden, weil sie qualitativ eben gut bis hervorragend waren.
Man wird ihn nicht viel nach den Gründen für seinen Aufenthalt gefragt haben, denn es war damals üblich, dass vor allem gebildete Juden nach Ägypten auswanderten und Alexandria war meist die erste Station. Viele verteilten sich dann über die anderen ägyptischen Städte oder reisten per Schiff weiter zu den anderen großen Städten – da von Alexandrias Hafen täglich viele Schiffe in alle Richtungen ablegten und ankamen, war dieser Stadt auch wegen ihres Hafens die Stadt der ersten Wahl. Eine Unterkunft also wird er schnell gefunden haben, für ein eigenes Haus brauchte er vielleicht etwas länger, denn so schnell fand sich kein leer stehendes, aber auch das fand sich endlich an und Judas konnte daran gehen, in diesem Haus mit dem Lehrbetrieb anzufangen… zunächst mit interessierten Juden, aber er gedachte, es nicht dabei zu belassen. Auch viele Ägypter und Griechen hatten schließlich ganz ähnliche Interessen und vor allem an den Ägyptern war ihm gelegen, denn er wusste wohl, dass seine Lehre eigentlich aus Ägypten stammte, aber hier, in Alexandria war sie auch den Ägyptern meist fremd und neu. Die geistliche Creme der ägyptischen Gesellschaft lebte nicht hier, sondern an den fernen Hochschulen in Philae oder in Edfu. Zwar unterhielt auch der Serapistempel eine Art Akademie, aber mit deren Mitgliedern war er noch nicht zusammen gekommen, kurz gesagt, er hatte wie es so schön heißt, einen Bammel oder Fracksausen, wie man will. Der in Aussicht genommene Schülerkreis bedingte aber, dass Judas sich an einem anderen Ort als im Judenviertel niederließ, in das Griechen wie Ägypter nur höchst ungern kamen. Gesagt, getan, das Haus wurde verkauft und eines im Bereich wahrscheinlich des Serapeums erworben, wo es auch bedeutend ruhiger war. Wie das, wo doch in einem ägyptischen Tempel von früh bis spät reges Leben herrschte? Nun, das Serapeum lag außerhalb des ägyptischen Bezirks und gehörte eher zu den Staatsbauten als zu den „Gemeindekirchen“. Nur zu den großen Staatsfesten fanden hier Veranstaltungen statt… das Serapeum war sozusagen das staatsoffizielle Gesicht einer Dynastie, die wusste, dass sie auf ihr Hinterland angewiesen war und blieb und dieses Hinterland war eben zumeist[12] ägyptisch, sprach seine eigene Sprache und hatte seine eigenen Götter. Hingegen Serapis war eine griechisch – ägyptische Mischung, eine Kreuzung aus Zeus, dem ägyptischen Ptah und dem ebenfalls ägyptischen volkstümlichen Osiris, von dem er allerdings keine Attribute trug, sondern nur den Namen hatte, während zu Ptah gleich zwei Merkmale gehörten: einmal die Säule Djed – Beständigkeit, Dauer, Ewigkeit die dem Stab des Ptah nachempfunden war, zum anderen der Name Apis, der den aktiven Bestandteil des Ptah, seinen schöpferischen, im zeugenden Stier verkörperte. Amun und Re indes, die beiden anderen Götter hatten keine Aufnahme in diese letzte ägyptische Reichsgottheit gefunden. Sie fristeten im Hinterland eine zwar geachtete, aber unauffällige Existenz. Ach, übrigens: zu staatlichen Ehren hatte es auch Isis gebracht, in der die uralte ägyptische Hochachtung der Frau von der griechischen Dynastie aufgenommen worden war – ihr Tempel befand sich auf Lochias, auf der äußersten Spitze der Halbinsel, und war dem allgemeinen Publikum nicht zugänglich, da er sich auf Königsland befand, aber seine bunten, bewimpelten Pylonen begrüßten jeden Reisenden. Den Griechen war der Kult, der den Ägyptern selbstverständlich war, völlig fremd, dennoch – dieser Tempel auf dem Königsgelände war wichtig, galt Isis doch auch als die Beschützerin des Thrones und Herrin aller Zauberei und die mochten die Ptolemäer dann und wann wohl nötig gehabt haben, denn sie waren eine recht zänkische und intrigante Dynastie, in der einer dem anderen das Brot neidete, das er aß.
Die Einwohner Alexandrias aber kamen mit der Dynastie so gut wie nicht in Berührung, die Ptolemäer lebten für sich abgeschlossen in der Basileia und kamen nur ein paar Mal bei großen Festlichkeiten in und durch die Stadt. Es interessierte sie schlicht niemals, wen sie regierten und der Stadt kam dieses Desinteresse einer in Formalien erstickten, politisch profillosen und programmatisch verwaschenen und verschlissenen Familie zupasse. Sie, die Stadt und die Dynastie behinderten einander nämlich nicht nur nicht, sondern der leere Geltungsdrang war auch sehr dienlich, um die Wohlfahrt der Stadt zu erhalten. Man sollte über Alexandria in Ägypten nichts, aber auch nichts Nachteiliges sagen können und so schossen die vornehmen Herbergen, die exklusiven Gastwirtschaften, die teuren Einkaufscenter ins Kraut, aber auch die Theater und die philosophischen Klubs, Wissenschaftler aus allen Himmelsrichtungen unterrichteten am Museion, aber auch Künstler aller Sparten trugen dort ihre Werke vor und ließen sie aufführen. Da fiel es und deshalb erzähle ich das überhaupt, gar nicht auf, wenn ein Jude in bester Lage eine private Akademie eröffnete. Andererseits aber verhalf der vornehme Ort etwas abseits der Touristenpfade und des Kaufrummels, aber gut erreichbar, dem Ort zu genau jener Exklusivität, ohne die eine Neuerung in Alexandria nicht bestehen konnte. Die Anfänge der Akademie waren gleichwohl bescheiden, das Interesse hielt sich in Grenzen, in sehr engen Grenzen und es war gut, dass Judas das neue Haus nicht etwa auf Pump gekauft hatte, denn fürs erste war er selber des Öfteren auf Einladungen zum Essen und auf die Gaben von Freunden angewiesen, die Zahlungen, die aus Israel immer noch eingingen, deckten den Bedarf nicht.
Sergius Paulus
Das änderte sich erst als ein neugieriger Römer das Haus betrat, ein gewisser Sergius Paulus aus uraltem römischen Adel, der in der Nachbarschaft, auf Zypern, das Reich vertrat und auch Alexandria, das doch so nahe lag, besuchen wollte – mit einem schnellen Schiff war man in Stunden dort, Der Mann hätte von Königen empfangen werden können, ohne dass die sich selber Schande machten und sicher wurde er das auch aber Ägypten gehörte nun einmal zum Reich, also kam er nur als Schaulustiger, einmal, zweimal… und dann immer wieder sobald er Zeit fand, denn er hatte dort etwas und jemanden entdeckt. Natürlich hielt er nicht den Mund, sondern empfahl seine Entdeckung den Kollegen… also wenn ihr euch mal wirklich langweilt, dann. und die Empfehlung wirkte in beide Richtungen: Judas bekam zahlende Schüler und die Römer bekamen eine neue Philosophie, die bald überall verbreitet sein sollte. Ein bisschen ähnelte sie bereits bekannten – und anerkannten – Modellen, aber sie führte weiter, viel tiefer hinein in alles, als das Bisherige und – sie quälte die Menschen nicht mit Lehrsätzen und Verhaltensregeln, sondern sie nahm ihr Leben wie es war und machte daraus was man irgend nur machen konnte. Wer diese Lehre bis zum Ende durchlaufen hatte, der war im wahrsten Sinne dieses Wortes neu geboren und in allem sein eigener Herr und das kam der Praxis einer mitunter schwierigen Amtsaufgabe wohl entgegen und war sehr nützlich. Daher, weil sie so nützlich war, nannten sie diese Lehre auch die nützliche Lehre und ihren Lehrer nannten sie den Nützlichen = den Chrestos. Sie brachten ihre Kinder und Nachfolger zu Didymus, damit er auch sie unterrichte. Als sie fragten, ob sie auch die Frauen bringen könnten – aber sicher, vernahmen sie, die Lehre wäre für alle Menschen. Aber sie sollten sich keine Illusionen machen – gehorsame Ehefrauen gewännen sie dadurch nicht. Ob diese Lehre auch für Sklaven nützlich wäre – die Antwort fiel nicht ganz eindeutig aus, denn das würde bedeuten, dass diese Sklaven dann auch besser gehalten werden müssten. Indessen würden sie ihr Sklavenlos vielleicht besser ertragen, wenn sie Klarheit darüber besäßen, dass dieses erstens nicht alles und zweitens ihre innere Natur frei wäre und auch immer frei bleiben würde. Sklaven? Nein, niedrigstehende Freunde, sollte Seneca später lehren, den sie einen Stoiker nannten, der aber ein Philosoph war. Wer sich an solche Gedanken nicht gewöhnen konnte – und die Inhaber großer Gutsbetriebe und Manufakturen konnten das in der Regel nicht – ließ sich besser nicht herab, auch die Sklaven zu den Chresten zu schicken oder einen Chrestos als Hauslehrer anzustellen. Ansonsten ist der Beitrag, den die Chresten für die römische Kultur leisteten schlechtweg gar nicht abzuschätzen, geht doch beinahe alles, was seit der Kaiserzeit an ethischen Normen entdeckt und verwirklicht wurde, auf sie zurück. Sicher – Sklaven gewannen nun einen größeren Einfluss auf das römische Leben, sei es als Freigelassene, sei es als Haussklaven und Sekretäre der Kaiser und ihrer Gouverneure. Früher hatte man einen Sklaven nur dann freigelassen, wenn sein Unterhalt mehr kostete, als er leisten konnte und sich im Übrigen nicht mehr um ihn gekümmert. Jetzt gestattete man den Sklaven, so viel Eigenbesitz zu sammeln, dass sie sich selbst freikaufen könnten, was dazu führte, dass viele Sklaven kleine Eigenbetriebe gründeten, deren Ertrag sie behalten durften. Das wiederum führte dazu, dass sie sich auch als Freigelassene ihren ehemaligen Herren verpflichtet fühlten, die ihnen ja die Freiheit zwar nicht geschenkt, aber ermöglicht hatten… soziale Zellen entstanden, in denen einer dem andern zuarbeitete und da die Kinder von Freigelassenen bereits das römische Bürgerrecht erwerben konnten, kam es gemach zu jener Durchmischung, welche die anachronistischen Strukturen des republikanischen Rom aufweichte und eine neue, nicht mehr auf Landbesitz, sondern auf Verdiensten und Erfolgen beruhende Schichtung der Bevölkerung schuf. Sie begegnet uns, voll ausgebildet, im Laufe des zweiten und dritten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung und sollte ihrerseits zum Geburtshelfer der spätrömischen Gesellschaft werden, indem sie gemach alle Schichten und Klassen durchzog und einander anglich, ohne sie gegeneinander einzuebnen. Die Gesellschaft wurde durchlässig, was sie in den Tagen des Judas noch ganz und gar nicht war. Damals trennte zum Beispiel einen jüdischen Talmudgelehrten alles von einem römischen Präfekten, diesen aber nichts von einem griechischen Philosophen, der zudem mit seiner Lehre auch noch Erfolg hatte. Die römischen Nobiles[13] veranstalteten regelrechte Wallfahrten nach Bildungszentren wie Athen, Rhodos und eben auch Alexandria und reichten ihre Lehrer einander herum. So wird wohl auch Sergius Paulus zu dem Kontakt mit „Didymos“ gekommen sein, der inzwischen sicher das helle und ein wenig trockene Alexandriner Griechisch sprach und schrieb und nur für sich zuweilen noch in Aramäisch dachte. Ein leichter Akzent mag sich erhalten haben, der aber keineswegs „jüdisch“ klang, sondern auch der eines Syrers oder Persers sein konnte. Schlagfertig wird dieser Lehrer gewesen sein und humorvoll, denn Jesu Lehre ist alles andere als bärbeißig und dogmatisch und es ist kein Wunder, dass Judas alias Didymos bald zu den engeren Freunden des Sergius Paulus zählte als der er auch in der Apostelgeschichte des Lukas erwähnt wird, dort allerdings unter seinem aramäischen Namen Thomas, in syrischer Schreibweise Etoimas, was über mehrere Redaktionen dann zu Elymas wird und da man ihn den Großen nannte, wird aus dem Megas, dem Großen, der Magos, der (persische) Magier. Diese Technik des Verfälschens von Nachrichten ist uns aus anderen neutestamentlichen Quellen ja bereits vertraut.
Ob Saul den Judas wirklich getroffen hat, muss unwahrscheinlich bleiben – sicher ist allerdings, dass den Christen an einem solchen Zusammentreffen gelegen war, und zwar nicht nur deshalb, weil sie hier den ungeliebten Judas einmal mehr wenigstens auf Papyrus besiegen konnten, sondern noch aus einem ganz anderen, viel ernsthafteren Grund: Sergius Paulus hat dann, nachdem seine Amtszeit abgelaufen war, wie man so sagt die Pferde gesattelt und hat sich auf Reisen begeben um die Philosophie seines Freundes und Lehrers überall im Reich zu verbreiten. Er hat über diese Reisen Buch geführt und einen Bericht veröffentlicht, der dem Christen Lukas in die Hände fiel und den er schlankweg für seine Religion stahl. So ist aus dem Juden Saulus der römische Bürger Paulus geworden, der gleichwohl Jude blieb[14]… was in dieser Zeit nur mehr von Flavius Josephus allgemeiner bekannt war und dieser mit seinem Werk über den Jüdischen Krieg samt ausführlicher Vorgeschichte auch noch an anderen Stellen der Apostelgeschichte des Lukas Pate steht. Nur das eigentliche Thema, die Zerstörung Jerusalems im Jüdischen Krieg lässt Lukas aus, denn das würde ihn ja als einen Zeitgenossen des Josephus entlarven oder auf ein noch späteres Datum hinweisen. Bezeichnenderweise geht aber von diesem vorgeblichen Zusammentreffen die Umbenennung des Saulus als Paulus aus – wahrscheinlich war es dem Verfasser zu mühsam, überall in des Sergius Paulus Reisebericht den Namen zu verändern. Er beschränkte sich darauf, statt der wirklichen Aussagen des Paulus überall fromme Sentenzen und Wunderberichte einzukreuzen. Das ist kriminell? Aber die gesamte neutestamentliche Überlieferung ist kriminell, fälscht und verdreht wo es nur angeht.
Grüße nach Philippi
Unter den vielen Papieren, welche die Geschichte des frühen Christentums begleiten, ist auch ein Brief, den „Paulus“ an eine Gemeinde in Philippi in Mazedonien richtet. Der Brief ist an und für sich historisch ganz und gar uninteressant, er enthält nur christliche Theologie, aber eines ist dann doch bemerkenswert: „Paulus“ lässt in Philippi den „ehrenwerten Zwillingsgenossen“ grüßen. Sicher – wir haben es hier wiederum mit einem Vereinnahmungsversuch zu tun, soviel ist unbestreitbar, aber – enthält diese kurze Passage vielleicht einen wahren Kern? Ist Judas etwa im Alter nach Mazedonien gezogen? Was kann er dort gewollt haben, in dieser wahrhaft von der Geschichte vergessenen Ecke? Und hat etwa der echte Sergius Paulus ihn dort aufgesucht oder sonst Kontakt mit ihm gehalten? Musste es der falsche Paulus dann auch tun um sich nicht als Unwissender zu offenbaren? Nehmen wir einmal an, dass die Gemeinde in Philippi wirklich bestand und dass es sich wirklich um Philippi in Mazedonien handelt und nicht um eines der vielen Philippi in der kleinasiatisch – syrischen Sphäre. Dann fällt Judas, sollte er wirklich dort gelebt haben, als Angehöriger einer solchen Gemeinde von vornherein aus, denn die Gewaltsamkeit, mit der man ihn einzugemeinden bestrebt ist, andererseits aber aus dem Christentum heraus halten möchte, fällt geradezu auf. Es ist klar: die Christen bekommen Gegenwind und wissen sich nicht anders zu helfen, als indem sie ebenfalls eine „Thomastradition“ entwickeln. Ohne eine solche, stellen sie bald fest, ist ein Eindringen in maßgebliche Kreise der römischen Gesellschaft nicht möglich. Aber selbstverständlich muss sie im christlich – religiösen Sinne umgedeutet und umgebogen werden. Und so wird der große Antipode Judas zum lammfrommen Senior einer christlichen Gemeinde im fernen Mazedonien, sozusagen hinter den Wäldern, den man ehrerbietig grüßt und dabei in Wahrheit kräftig Ehrabschneiderei betreibt als wolle sich Hitler auf Karl Marx berufen. Beruhigender Weise ist zu sagen, dass diese Taktik nicht den gewünschten Erfolg hatte; erst der neuerliche Krimi um Konstantin machte „der Philosophie“ vorerst ein Ende. Aber ohne gewaltige Anleihen beim Werk des Judas zu machen, war es nicht möglich, das Verwirrspiel um die neue römische Universalreligion zu einem für die Christen günstigen Ende zu bringen und wie wir wissen, brachte ja Konstantin dieser Religion lediglich die Befreiung vom Odium des Menschenhasses, nicht aber die Anerkennung als römische Staatsreligion. Diese erfolgte erst beinahe hundert Jahre später und unter einem ganz anderen Kaiser, nämlich Theodosius I. Konstantin der Große blieb lebenslang der Philosophie verbunden unter deren Zeichen er gesiegt hatte.
Was für uns dabei wichtig ist: durch Jahrhunderte und über den Zerfall des römischen Reiches hinaus blieb die Philosophie, die mit Jesu Namen und dem Namen des Judas verbunden ist, bestehen, auch wenn sie durch die Zeit ihre Namen und Erscheinungsweisen veränderte – sie blieb stets, was sie schon im Anfang gewesen war: eine Methode, um den Sinn des Lebens für jeden Einzelnen zu finden und in diesem Finden den Sinn des Lebens überhaupt. Alle Versuche, sie zu entstellen, sind früher oder später an sich selbst zugrunde gegangen und im Christentum ist sie überhaupt nicht mehr auffindbar, so viele Versuche es auch gegeben hat, das was so ähnlich klang, im Nachhinein auch miteinander zu verbinden. Keiner dieser Versuche erwies sich als lebensfähig. Wir kennen sie heute als das Phänomen eines gnostisierenden sektiererischen Christentums, das sich momentan gerade in der marktorientierten Esoterik, der Beliebigkeitsreligion des globalistischen Zeitalters, verliert.
Schlusswort
Irgendwann, an unbekanntem Ort und zu unbekannter Zeit ist Judas gestorben, aber sein Tod war, wie gesagt, nicht das Ende der Philosophie die er im Auftrag seines Meisters gelehrt hat, wie Xenophon die Philosophie des Sokrates lehrte, ohne ihr, wie Plato es tat, ein eigenes Machwerk an die Seite zu stellen, auch ohne, wie Simon Petrus, aus Fragmenten der Lehre eine Religion zu zimmern auf deren Grundlage er sich dann profilierte. Judas blieb stets im Schatten, trat hinter dem Werk seines Meisters zurück – dennoch bewahrte auch er sich ein Gedächtnis bei denen, die durch beinahe zwei Jahrtausende dieser Philosophie folgten. Noch aus dem Mittelalter ist belegt, dass man ihm jene Verehrung entgegen brachte, die einem verdienstvollen Menschen gebührt, an die Wände ihrer Höhlen schrieben die schon unterdrückten Katharer die Initialen seinen „Spitznamen“ und die Initialen seines Titels und in besseren Zeiten werden sie sein Gedächtnis sicher noch auf andere Art bewahrt haben. Im sechzehnten Jahrhundert, im Schatten der Reformation, taucht sein Leitfaden wieder auf und gerät in die Hände eines Menschen, der die Sprüche sogar versteht und sieht, welche Chance für das Christentum in ihnen liegt – sich von einer Religion zu einer Lebensweise zu wandeln, in der für soziale Brüche und Ungerechtigkeiten kein Platz mehr ist. Der Man wird geköpft, die Katharer wurden wahrscheinlich verbrannt. Denn die Zukunft gehörte und gehört der Religion des Simon Petrus, dieser Zusammenballung philologischer und historischer Kriminalfälle, die bereits in ihren ersten Anfängen das intendiert, was dann später zu ihrem alles beherrschenden Merkmal wird: der religiöse Fanatismus, der in einer christlichen die einzig mögliche Welt sieht.
Und dann – taucht sein Werk nach beinahe zweitausend Jahren des Hintangesetzt Seins und der Vergessenheit wieder vollständig auf und steht bereit, der simonischen Lüge den Todesstoß zu versetzen indem sie Jesus zeigt, wie er wirklich dachte. Wie aber wird die christliche Welt nun mit diesem Erbe umgehen? Während Hardliner aller Konfessionen, die sonst bereit sind, jeden Schnipsel um mindestens hundert Jahre zurück zu datieren um möglichst frühe Indizien für das Christentum zu haben, sich beeilen, diesen Fund möglichst spät zu datieren, setzt sich die Einsicht immer mehr durch, dass wir es hier mit einem Dokument frühester Herkunft zu tun haben – noch weit vor allen Evangelien und sonstigen christlichen Schriften. Während einige versuchen, es in seiner Aussage dem Neuen Testament anzugleichen, sehen andere durchaus das Einzigartige und Andere darin und übersetzen ohne Lug und Trug das, was da steht. Dass aber dieses da ist und dass sich die Geister an ihm entzünden können, vorsichtig und weniger vorsichtig, leugnend und bejahend, ist Verdienst des Judas und – wir brauchen es nicht, jenes späte „Evangelium“ welches den Judas den Verräter in den Kreis der Zeugen wieder hinein holen will – den gab es nie und also ist auch das verlorene Liebesmüh, zudem: wir haben noch das echte Wort, die echte Lehre, die Judas überliefert hat, wir brauchen keine frommen Traktätchen, die auf gewundene Weise Gerechtigkeit da schaffen wollen, wo niemals Ungerechtigkeit gewesen ist. Ich wage zu sagen: in hundert Jahren, wenn dieser Spuk hier auf Nimmerwiedersehen vorbei sein wird, wird diese Philosophie an den Schulen gelehrt werden so wie heute das Christentum an den Schulen gelehrt wird und wo heute Korruption den Ton angibt, da wird wieder darauf gesehen werden, dass Verantwortung – heute eine Floskel – nur der bekommt, der gut nach Jesu Lehre sich selbst gefunden und im Griff hat. Schade, dass ich diese Menschheit nicht mehr als die erleben werde, die ich heute bin….
Berlin, im Mai 2012
Juliane Bobrowski
(alle Rechte beim Autor)
[1] Man fragt sich, warum das nicht mit mehr Krakeel erwähnt wird? Wie soll man es Juden beibringen, dass ihr Allerheiligstes nicht durch Krieg, sondern durch die Tat eines Einzelnen abhanden kam? So muss ein einziger Satz, hineingeschrieben in die Zeit Nebukadnezars, genügen, um das Nichtvorhandensein derselben zu erklären. Die Priester indessen wussten über den wahren Sachverhalt Bescheid und waren Jesus auf den Fersen, als er sich am Meeresstrand von seinen engsten Schülern verabschiedet. Bei diesem Abschied ist auch Judas zugegen.
[2] Wenn dem so wäre, wäre dies ein epigraphisches Werk aus dem dritten oder vierten Jahrhundert unserer Zeitrechnung das in Aramäisch verfasst und sowohl in Griechisch wie auch in Koptisch im gesamten Römischen Reich vorhanden wäre… wobei die Crux vielleicht hauptsächlich darin bestände, im dritten oder vierten Jahrhundert unserer Zeitrechnung den Gebrauch des Aramäischen als Literatursprache in Palästina nachzuweisen.
[3] Gemeint ist die Euphrasius – Basilika in Pore?/Istrien.
[4] Es ist das normale Verfahren der Unterweltsfahrt das mit dem Eintritt in die nächste existenzielle Dimension, genannt Licht, abschließt um dann mit der Erkenntnis des Selbst weiter zu gehen. Dabei kann es geschehen, dass, überwältigt von der neuen Existenzweise, der Betreffende sozusagen die Leine loslässt und als Mensch stirbt – was wie schon gesagt nicht der Sinn der Sache ist, aber Judas geht ja, wie berichtet wird, allein hinüber, Jesus ist nicht an seiner Seite, um auf ihn acht zu geben. Die genannte Musterarbeit verrichten wir übrigens immer noch und sie ist auch immer noch effizient.
[5] Die „breite Straße“ die via lata war traditionell die Hauptstraße eines Ortes. An ihr lagen alle Gebäude, die irgendwie von öffentlichem Interesse waren und auch die Häuser der Honoratioren.
[6] Der alexandrinische Freund des Herodes, der als Hoher Priester den Tempelfrevel deckte, denn er allein durfte ja das Allerheiligste betreten und so wusste allein er, dass es leer war.
[7] Das bedeutet, dass in diesem Kontext des Tempelfrevels natürlich auch Spekulationen bezüglich Persiens, Indiens oder Chinas ausfallen, denn in all diesen Kulturen kannte man ein solches Verbrechen und – in all diesen Kulturen lebten Juden, die wiederum mit anderen Juden Kontakt pflegten. Der einzige „judenfreie“ Bezirk im Römischen Reich oder in seiner Nähe waren Germanien und der Norden der britannischen Insel.
[8] Ach übrigens, die berühmten Belegstellen über Jesus bei Josephus sind samt und sonders Fälschungen späterer nachkonstantinischer Tage. Immerhin aber verdanken wir es ihnen, dass wir das Gesamtwerk des Josephus überhaupt noch haben und das, finde ich, ist dann schon ein paar Fälschungen wert…
[9] Was sagen soll, dass sie auf jeden Fall später entstanden sein muss, wenn sie derartige Ereignisse einbezieht. Ich vermute, dass sie in den Jahren zwischen dem Jahr 50 und dem Ende des ersten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung feste Formen angenommen hat.
[10] Bei Ephesos überschnitten sich allerdings wie auch in Delphi, touristische und religiöse Motive.
[11] Durch ein schreckliches Erdbeben und durch böse Erdrutsche hat es ab dem zweiten Jahrhundert unserer Zeitrechnung allerdings sein wundervolles Panorama verloren.
[12] Es gab auch griechisch geprägte Siedlungen wie Naukratis, die alte Griechenstadt, oder jüdisch geprägte, wie Jeb im Süden, das sogar einen eigenen Tempel hatte. Aber diese Niederlassungen, noch aus ägyptischer Zeit, waren Fremdkörper im Land.
[13] Aus den alten römischen Adelsklassen der Patrizier und Plebejer schon seit Julius Caesar sich vermischende neue Oberschicht. Dabei galten Angehörige des ersten und zweiten Adels (Altadelige und sogenannte Ritter) beide als Angehörige der Nobilität, obgleich es zwischen ihnen noch Standesunterschiede gab, zum Beispiel konnten Ritter keine Sitze im Senat innehaben, was ohnehin aber mehr und mehr zur Formsache geriet.
[14] Dass Juden allerdings das römische Bürgerrecht erhielten, wenn sie aus dem Judentum ausschieden, war ein eher bekanntes Verfahren, das zum Beispiel den Gouverneur von Alexandria, einen Zeitgenossen Vespasians, betrifft.